jungkonzept, das sind leuchtende ideen
hier wird geforscht, erprobt und manchmal veröffentlicht
bringing words to actions: what_i_do = [„write“, „create {tech, research, sound}“, „repeat“] for x in what_i_do: print(x)
filter
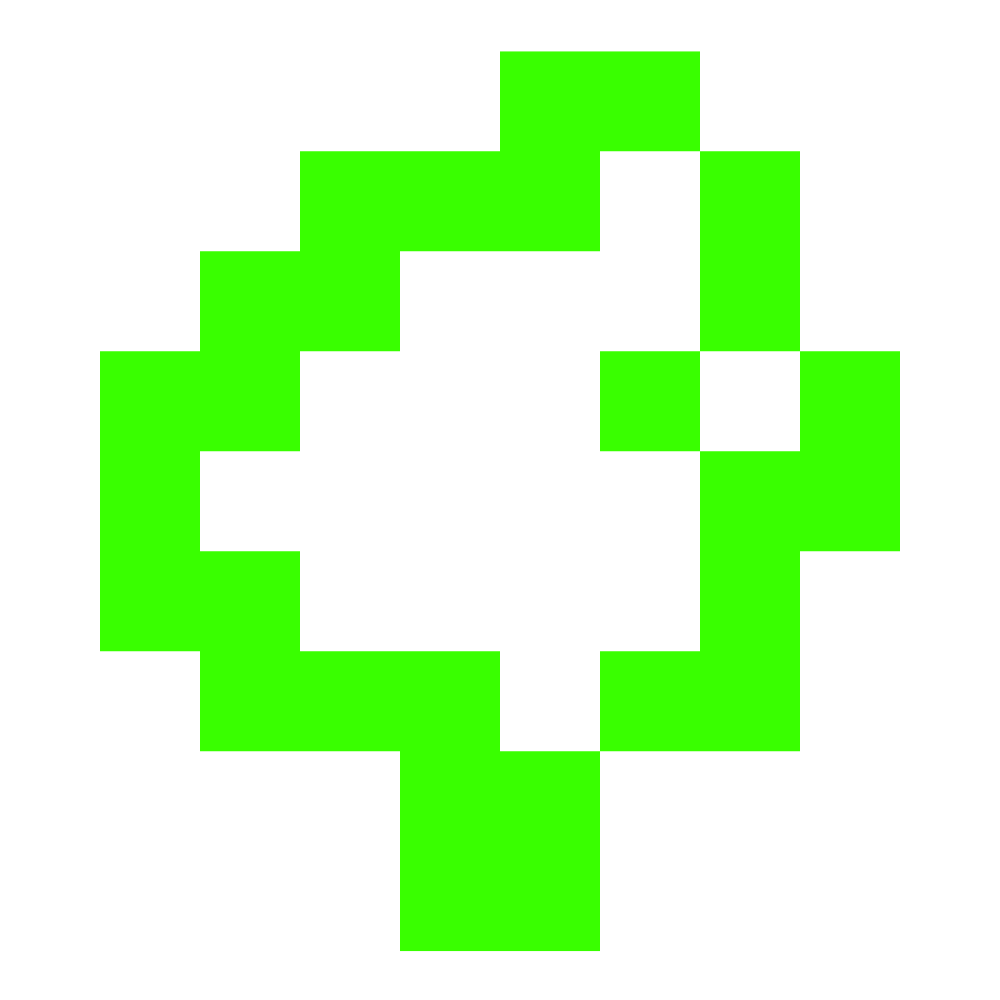
inspiriert von daten, technik und klang. <3